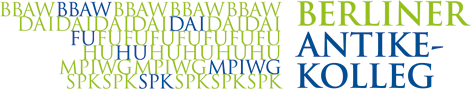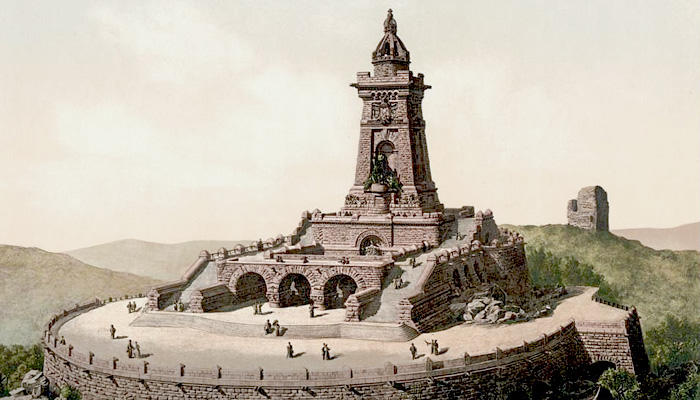Je stärker autoritäre Gegenentwürfe zur offenen Gesellschaft mit historischen Narrativen hinterlegt werden, desto mehr wird die Deutung der Vergangenheit zu einem Instrument der Auseinandersetzung um die Gestaltung der Zukunft.
Ein aktuelles Beispiel ist die gegenwärtige Wiederentdeckung von Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes (1918) durch antiliberale Historiker:innen und Vertreter:innen der Neuen Rechten. Spengler beschreibt hier den zyklischen Aufstieg und Niedergang paradigmatisch unvermischter, "identitärer" Kulturen. Dabei greift er überkommene, wirkmächtige Konzepte auf, wie die Idee kultureller Reinheit, die Beschreibung historischer Epochen am Modell des Lebenszyklus’ biologischer Organismen, die geschichtsphilosophische Figur der ewigen Wiederkehr des Gleichen und das Endzeit-Denken der Apokalyptik. Daraus konstruiert Spengler ein weltgeschichtliches Panorama, dessen großer öffentlicher Erfolg in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in eklatantem Widerspruch zum wissenschaftlichen Niveau des „halbgebildeten Scharlatan“ (Harry Graf Kessler) steht, wie schon zeitgenössische Rezensenten betonten.
Natürlich werden die Auswahl, Analyse und Interpretation historischer Quellen und Befunde stets von der "Episteme" – dem historischen Wissensfundament ihrer Zeit – geleitet und von politischen und weltanschaulichen Präferenzen der Forscher:innen gelenkt. Jede Rekonstruktion und Erzählung der Vergangenheit enthält deshalb Elemente von "Verzerrung".
Und doch besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen einer wissenschaftlich motivierten Herangehensweise, die auf einem regulativen Wahrheitsbegriff, einer erprobten Fachmethodik sowie rechenschaftsfähiger Quellenkritik und -hermeneutik basiert und historischen Narrativen, die in erster Linie politisch motiviert sind und gezielt für ideologische Zwecke eingesetzt werden.
Hier setzt das Jahresthema 2025/26 des Berliner Antike-Kollegs unter dem Titel "Antike im Zerrspiegel politischer Ideologien" an. Es soll dazu anregen, die Spannung zwischen dem komplexen Bedingungsgefüge historischer Interpretation und der Indienstnahme historischer Narrative für politische Agenden interdisziplinär zu beleuchten, Zusammenhänge und Unterschied zwischen methodenbasierter Arbeit am antiken Quellenmaterial und dessen ideologischer Ausbeutung und politischer Instrumentalisierung differenziert zu diskutieren und so die Bedeutung der Erforschung der Antike für die Gegenwart aufzuzeigen.
Im Rahmen des Jahresthemas 2025/26 wird das BAK ein vielfältiges Programm aus wissenschaftlichen Beiträgen, öffentlichen Vortragsabenden und Gesprächsformaten mit Vertreter:innen involvierter Wissenschaften, Studierenden und der interessierten Öffentlichkeit veranstalten.