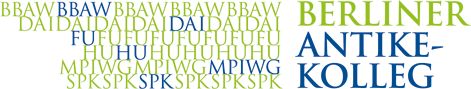Felix Zander Dipl.-Theol.

Ancient Languages and Texts (ALT)
Theology
Theologische Fakultät
Burgstraße 26
10178 Berlin
Akademische Laufbahn
ab 2025
Promotionsstipendium bei der Gerda-Henkel-Stiftung
2024
PreDoc-Stipendium der BerGSAS
ab 2024
Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin, Theologische Fakultät (Erstgutachter: Prof. Dr. Markus Witte)
2017 – 2024
Studium der Evangelischen Theologie (Erstes Theologisches Examen) an der Humboldt-Universität zu Berlin
2015 – 2017
Bachelorstudium der Germanistischen Linguistik und Evangelischen Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin
Berufserfahrung und Projekte
2022 – 2023
Mitwirkung an der archäologischen Ausgrabung auf dem Tell Keisan (Israel)
ab 2021
Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl Literaturgeschichte und Theologie des Alten Testaments (Humboldt-Universität zu Berlin, Theologische Fakultät)
2018
Studentische Hilfskraft am Exzellenzcluster TOPOI unter Prof. Dr. Cilliers Breytenbach
Weltuntergang oder Neuanfang? Zephanja zwischen Prophetie und Apokalyptik (Arbeitstitel)
Das Projekt beschäftigt sich mit dem Zephanjabuch (Zeph) im Alten Testament. Das kurze, aber inhaltlich dichte Buch, das als „Kleinkompendium“ alttestamentlicher Prophetie bezeichnet wird (Irsigler u.a.), nimmt eine zentrale Stellung im Zwölfprophetenbuch ein, insofern es sich in der Narration um das letzte Buch eines vorexilischen Propheten handelt. Das Projekt ist an Fragen der Textüberlieferung sowie an kanonspluralen und rezeptionsgeschichtlichen Perspektiven interessiert. Daher wird es den hebräischen Text ins Gespräch bringen mit der griechischen Übersetzung der Septuaginta, den (eher fragmentarisch erhaltenen) Zeph-Kommentaren (Pesharim) aus Qumran, den spätantiken lateinischen Versionen und nicht zuletzt der nur in koptischen Fragmenten überlieferten Zeph-Apokalypse(n).
Im Fokus steht dabei v.a. die Frage nach Bezügen von Zeph zur Apokalyptik. Immer wieder diskutierte die Forschung, inwieweit sich bereits im hebräischen Buch (proto-)apokalyptische Motive und Fortschreibungen finden lassen. Schließlich ist eine apokalyptische Rezeption von Zeph spätestens in den nachchristlichen koptischen Fragmenten belegt. Inwieweit lässt sich diese Rezeption anhand bestimmter Motive nachzeichnen? In welchem Verhältnis stehen dabei Prophetie und Apokalyptik zueinander? Lassen sie sich überhaupt so scharf voneinander abgrenzen?
Die Beschäftigung mit der apokalyptischen Rezeption von Zeph wirft auch einen neuen Blick auf die Verwendung des Apokalyptik-Begriffs in der Forschung. Es ist ein allgemein bekanntes Problem, dass der Begriff „Apokalyptik“ oft unscharf und abwertend verwendet wird. Woran wird z.B. festgemacht, ob es sich bei einer Fortschreibung um eine „apokalyptische“ handelt? Und was zeichnet wiederum die Jenseitsreise der Zeph-Apokalypse(n) als einen „apokalyptischen“ Text aus?
Das Projekt will also den Dialog zwischen der Zephanja- und der Apokalyptik-Forschung aktualisieren und intensivieren. Geleitet wird es dabei immer auch von hermeneutischen Interessen: Wie kann die heutige Theologie angemessen mit unheilvollen und gewaltlastigen prophetischen und apokalyptischen Texten umgehen?
Die Dissertation wird gefördert durch ein Stipendium der Gerda Henkel Stiftung.